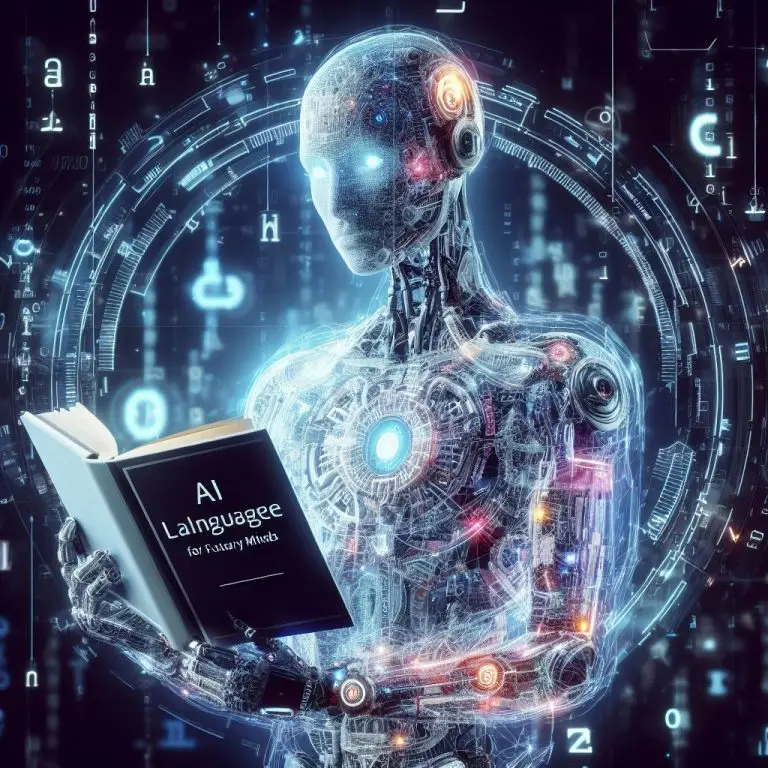Sprache im Mittelalter

Frank Reiser
Kategorien
Die Sprache im Mittelalter unterscheidet sich von der heutigen. Eine korrekte Rekonstruktion ist zum einen schwierig und zum anderen auch nicht wirklich sinnvoll – das gesprochene Plattdeutsch aus dem Mittelalter dürften die meisten von uns nicht mehr verstehen.
Schwierig ist es, weil kaum Texte auf Plattdeutsch aus der Zeit existieren. Es kommt hinzu, dass – selbst wenn wir entsprechende Texte haben – wir nicht sicher sein können, wie sie ausgesprochen werden. Es gibt keine einheitliche Rechtschreibung, Grammatik oder gar Lautsprache.
Die Klangarchäologin Mylène Pardoën hat in ihrem Projekt – wie klingt Paris im 18. Jahrhundert – bewusst auf eine Rekonstruktion der Sprache verzichtet:
„Niemand weiß, welches Französisch damals in Paris gesprochen wurde. Wir kennen das Schrift-Französisch, aber nicht die Mundarten. Viele Menschen sprachen ihre heimischen Dialekte. Auch, wie laut sie redeten, ist fraglich. Solange ich keine Beweise finde, wage ich es nicht, Sprache zu rekonstruieren.“
Mylène Pardoën


Sprache im Projekt „Kiel 1242“
Sprache ist aber ein wesentlicher Aspekt in meinem Projekt. Aus diesem Grund muss ich einen Kompromiss eingehen.
Ich kann davon ausgehen, dass im Wesentlichen Plattdeutsch gesprochen wird. In der gebildeten Oberschicht und im Klerus vermutlich auch Latein. Darüber hinaus werde ich auch Dänisch berücksichtigen.
Entgegen meiner Erwartungen spricht im Mittelalter in Kiel niemand Friisk – Nordfriesisch. Dies habe ich im Austausch mit dem Nordfriisk Instituut in Erfahrung gebracht.
Obwohl Kiel Mitglied der Hanse ist, sind Englisch, Französisch und Spanisch eigentlich nicht relevant – dafür ist Kiel als Handelspartner:in zu unbedeutend und diese Sprachen haben im Mittelalter noch nicht den Stellenwert und Verbreitungsgrad, den sie heute haben.
Das Projekt wird – so wie diese Website – in den Sprachen: Deutsch, Plattdeutsch, Latein, Dänisch, Englisch, Französisch und Spanisch zur Verfügung stehen. Allerdings in der heute gültigen Rechtschreibung, Grammatik und Aussprache.
Sprachsynthese mit KI
Ich habe schon in meinem Beitrag zur künstlichen Intelligenz dargestellt, warum das Projekt „Kiel 1242“ nur mit der Verwendung von KI zu realisieren ist.
Mit dem Tool von Elevenlabs kann ich einen Großteil dieser Sprachen automatisch generieren und das in relativ guter Qualität zu sehr geringen Kosten. Ein weiterer Vorteil ist Vielzahl der Sprecher:innen, aus denen ich auswählen kann.
So kann ich sicherstellen, dass in dem Projekt eine große Klang- und Sprachvielfalt realisiert werden kann. Madame Pardoën wird es mir hoffentlich nicht übel nehmen.
Mit dem Programm iClone von Reallusion und der dort integrierten Funktion LipSync ist es mir gelungen, eine größtenteils lippensynchrone Animation zu erstellen.